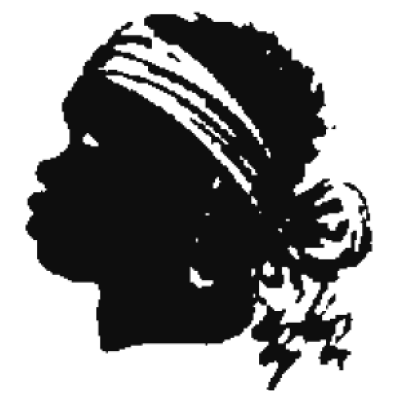Geschichte
Ursprung im Mittelalter
Die Compagnie der Schwarzen Häupter ist eine der ältesten Vereinigungen der Welt.
Ihre Geschichte ist eng verknüpft mit der Geschichte Europas, der Hanse, den wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen des Ostseeraumes und der baltischen Länder - bis in unsere Tage. ...Weiterlesen
Der hier dargestellte Abriss zitiert die wichtigsten in der Literatur zur Geschichte der Compagnie dargestellten Etappen.
Die Anfänge
Die Entstehung einer „Schwarzenhäuptergesellschaft“ in Riga, deren erster bekannter „Schragen“, ein selbstgesetztes Statut, aus dem Jahre 1416 stammt, dürfte schon früher zu datieren sein.
Die Compagnie der Schwarzen Häupter wurde erstmals im Jahre 1232 urkundlich bestätigt. ...Weiterlesen
Dabei besteht eine enge Beziehung zu dem von Bischof Albert gegründeten Schwertbrüderorden, der sich 1237 mit dem Deutschen Orden vereinigte. Darüber hinaus bestanden enge Verbindungen zur St. Georg Bruderschaft und zur Großen Gilde in Riga. Die Compagnie der Schwarzen Häupter gehört damit zu den prägenden Institutionen der neu aufblühenden mittelalterlichen Stadt an der Düna.
Bischoff Albert und Riga
In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts gelangten norddeutsche Kaufleute auf ihren Handelsreisen nach Russland verstärkt auch in das Gebiet, in dem die Düna in die Ostsee mündet.
Doch erst unter dem aus Bremen stammenden Bischof Albert I. (Albert de Bekeshovede, 1199-1229) begann die Missionierung des Gebietes. Er holte 1200 ein Kreuzfahrerheer nach Livland und verlegte den Bischofssitz von Üxküll nach Riga. ...Weiterlesen
Bischof Albert hatte Riga an einem durch den Riegebach gebildeten natürlichen Hafen gegründet – daher der Name Riga. Um ihn schloss sich – ähnlich wie in Lübeck, Bremen oder Wisby – die Stadt in einem Halbkreis. Im Nordwesten lag der älteste Dom mit dem Kapitel, von dort bis zum Markt reichte die älteste Bürgersiedlung, und im Südosten hatte der 1202 gegründete Schwertbrüderorden seit 1204/5 seine Niederlassung, den SL. Jürgenshof.
Angriffe aus dem russischen, estnischen und livländischen Raum, die auch die Handelswege unsicher machten, behinderten zunächst jedoch den Aufbau der neuen Stadt. 1225/26 erhielt sie durch den päpstlichen Legaten Wilhelm von Modena eine umfangreiche Mark zugesprochen, also umfangreiche Verwaltungsbefugnisse zur Sicherung dieser wichtigen Grenzregion.
Doch schon bald danach geriet die Stadt in Konflikt mit dem Bischof (ab 1255 Erzbischof), dem Schwertbrüderorden und seit 1237 auch mit dem livländischen Zweig des Deutschen Ordens, der sich einen Teil der Landesherrschaft sichern konnte.
In diese Zeit dieses Kampfes um die Macht in der aufstrebenden Stadt fällt auch die erste urkundliche Erwähnung Schwarzen Häupter.
Macht des Handels
Riga war der wichtigste Umschlagplatz für den Handel mit Russland. Nur wenige Kilometer von der See entfernt und nahe am Zusammenfluss von Riegbach und Düna gelegen, war die Stadt mit seetüchtigen Schiffen leicht zu erreichen.
Die Handelswege führten von hier nach Königsberg und Elbing im Südwesten, im Osten über Polozk nach Smolensk und über Pleskau nach Nowgorod, im Norden über Pernau nach Reval oder über Dorpat nach Narwa. ...Weiterlesen
Aus Rußland führten die Rigaer Kaufleute Pelze, Wachs, Teer, Talg, Leder und vieles mehr aus. Im Gegenzug importierten sie aus dem Westen Tuche, Salz, Heringe, Wein, Bier, Gewürze und Metalle. Früh der Hanse zugewandt, schloss Riga 1282 ein Bündnis mit Lübeck und Wisby und wurde die einflussreichste unter den livländischen Hansestädten.
Kampf um Riga
Kriege mit dem Deutschen Orden in der Zeit von 1297 bis 1330 endeten mit der Unterwerfung der Stadt, die dem Orden als Ersatz für das zerstörte Konventgebäude einen Platz für eine neue Burg abtrat.
Aus dieser Zeit ist, bestätigt seit dem Jahr 1334, in Riga auch die Gründung eines allgemeinen Versammlungshauses am Markt überliefert, eines sogenannten ,,Neuen Hauses": Das spätere Schwarzhäupterhaus. ...Weiterlesen
Auf weitere Zugeständnisse hin bestätigte der Ordensmeister des Deutschen Ordens die Rechte der Stadt. Gegen die Ordensherrschaft machte jedoch der Erzbischof bei der Kurie in Avignon ältere Rechte geltend, sodass der Orden 1366 auf die Kontrolle über Riga verzichten musste.
Doch der Streit zwischen Erzbischof und Orden dauerte fort, und die Stadt vermochte sich im Schatten dieses Streites eine recht große Freiheit zu verschaffen.
Herkunft des Namens
Die Ratsverfassung, Grundlage aller Stadtblüte im späten Mittelalter, ist für Riga seit 1226 bezeugt. Dabei weiteten die Gilden ihren Einfluss ununterbrochen aus, bis sie Mitte des 16. Jahrhunderts auch in Fragen der Finanzverwaltung und der Außenbeziehungen Rigas mitentscheiden konnten.
Die aus mehreren Zusammenschlüssen hervorgegangene Große Gilde traf sich bis zum Ende des 15. Jahrhunderts unter anderem auch im „Neuen Haus“ am Markt – dem späteren Haus der Schwarzen Häupter. ...Weiterlesen
Von dieser Großen Gilde trennte sich etwa um 1400 die Kompagnie der ledigen Kaufgesellen ohne feste Niederlassung, die Gesellschaft der Schwarzen Häupter. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts übernahm sie das „Neue Haus“. Aus dem Jahr 1416 stammt auch der älteste noch erhaltene „Schragen“ der Compagnie, die schriftliche Festlegung und Sammlung seiner Statuten.
In diesem Zusammenhang wird auch die Herkunft des Namens der „Schwarzen Häupter“ deutlicher. Quellen sprechen von einer „Gesellschaft Rigaer Kaufleute, die im Dienst des Rates und ihrer Handelsherren Handelsfahrten unternahmen, Schwarze Häupter genannt wurden und die Heilige Jungfrau Maria, den Heiligen Mauritius, die Heiligen Martin und Nikolaus sowie den Heiligen Georg verehrten.“
Und weiter heißt es bei Erik Thomsen: „Eigenartig und für sie charakteristisch bleibt die Benennung dieser Vereinigung. Man hat, allerdings nur auf Vermutungen gestützt, behauptet, dass der Name von den schwarzen Sturmhauben der Schwarzhäupter in Riga und Reval herrühre. Diese Benennung sei im Gegensatz zur Bezeichnung der Weißen und Grauen Häupter entstanden, die für die Ältesten der Großen Gilde schon früher gebräuchlich gewesen war. (…) Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Name „Schwarzhäupter“ von ihrem Schutzpatron, dem Heiligen Mauritius, hergeleitet wurde, dessen Kopf Signum und Wappen der Vereinigung ist.
Gemäß der Legende war Mauritius Kommandeur einer Legion, die zur Zeit der römischen Kaiser Diokletian und Maximian bei Theben in Ägypten aus vorwiegend christlichen Männern bestand. Bei der Überquerung der Alpen meuterten die 6600 Mann der thebaischen Legion, da sie nicht gegen die Christen ziehen wollten. Das Ereignis fand je nach Quelle im Jahr 302 oder 303 statt. Maximian gab erzürnt den Befehl, die Legion zu dezimieren, d. h. jeden zehnten Mann hinzurichten. Eine weitere Dezimierung führte ebenfalls nicht zum Erfolg, weshalb der Kaiser die völlige Vernichtung der Legion befahl. Ohne Gegenwehr hätten sich die Offiziere und die Mannschaften als Märtyrer für ihre Religion hinrichten lassen.
Die Verehrung des heiligen Mauritius war weit verbreitet und erstreckte sich in einem breiten Band vom westlichen Mittelmeer über das Rhonetal bis ins Baltikum. So tragen zum Beispiel die Insel Korsika und die Stadt Coburg sein Haupt in ihren Wappen. Er wird mit schwarzem Antlitz, oft gewappnet und in Rüstung, oft mit Stirnband dargestellt.
Rigas Artus-Hof
Es ist zwischen der Großen Gilde und den Schwarzen Häuptern nicht immer friedlich zugegangen. In den Quellen wird von mancherlei Unstimmigkeiten berichtet, die vorübergehend auch zum Bruch zwischen den beiden Benutzern des Neuen Hauses geführt haben und eine Einigung erforderlich machten. ...Weiterlesen
Diese fand am 15. Dezember 1477 in einem erneuerten Schragen ihre Bestätigung. Die Schragen wurden vervollständigt und ergänzt. Auch wurde dabei die Gerichtsbarkeit der Ältesten der Großen Gilde und der Schwarzhäupter neu geregelt. So heißt es dort: „Niemand soll mit der Gesellschaft der Schwarzen Häupter trinken, außer wer Bruder der Großen Gilde geworden ist und auf dem Hof [gemeint ist der Artushof, wie das neue Haus auch genannt wurde] gehen darf.“
In jener Zeit hatte der hanseatische Zustrom an Einfluss gewonnen. Das Neue Haus erhielt dadurch den Charakter einer öffentlichen Versammlungsstätte, die nach preußischem Vorbild bei feierlichen Gelegenheiten auch König Artus-Hof genannt wurde. Derartige Artus-Höfe haben auch in anderen Städten bestanden, in Elbing, Thorn, Braunsberg, Kulm und Königsberg in Preußen. Der bekannteste von ihnen steht in Danzig.
In einer „Afspröke" vom Jahre 1477, Montags vor St. Thomas, wird u.a. bestimmt: „Des Königs Artushof am Markt steht täglich das ganze Jahr offen, die Bürger der großen Gilde und die Schwarzen-Häupter gebrauchen ihn gemeinschaftlich zu ihrem Nutzen. Der Hof wird täglich um 1 Uhr Nachmittags geöffnet und um 9 Uhr geschlossen.“
Compagnie und Kirche
Über die Handelsfahrten der Rigaer Schwarzhäupter wissen wir nur wenig. Im Jahre 1414 fanden Seefahrten Rigaer Schwarzhäupter nach Lübeck statt, und es ist auch bekannt, dass sie sich im 15. Jahrhundert am Salzhandel beteiligten.
Doch über ihre Beziehungen zur Kirche und über ihre kirchlichen Interessen ist manches überliefert. Denn Kirche und Geistlichkeit hatten im Mittelalter machtvollen Einfluss auf das Leben in Stadt und Land. ...Weiterlesen
Diese enge Verbindung von Kirche und Bruderschaft lässt sich bereits im Schragen der Compagnie ablesen. Hier werden, wie Thomsen schreibt, ganz konkrete Handlungsvorschriften gegeben: „Am Martinsabend sollen die Schaffer drei Wachsfackeln haben, jede von einem Markt Pfund, bei welchen man Sankt Martins Lob singt. Freitags zu Fastnacht soll man die Verstorbenen Schwarzhäupter in der Sankt Katharinen Kirche mit Vigilien und sonnabends mit Seelen-Messen begehen. Dazu sollen die Schaffer drei Lichte machen lassen und Frauen bitten, dieselben zu tragen.“ So beteiligten sich die Schwarzhäupter seit dem Jahre 1413 an Stiftungen für die St. Katharinenkirche. Im Jahre 1421 gründete die Gesellschaft zu St. Katharinen eine Schwarzhäupter-Vikarie und einen Altar. „Ihre Kapelle befand sich an der Südseite der Kirche. Sie wurde reich ausgestattet. So befanden sich in der Kapelle neben dem Altartisch ein mit Silber und Gold gesticktes und mit dem Wappen der Schwarzhäupter geziertes Antependium, ein großes Kruzifix, ein Kronleuchter mit sieben Lichten, vier Lichterbäume, hohe Stehleuchter mit Dornen, auf welche große Wachskerzen gesteckt wurden, dazu zahlreiches Silberzeug.“ Zu den Schutzpatronen der Rigaer Compagnie der Schwarzhäupter gehörten die Jungfrau Maria, Hauptschutzpatronin des Livländischen Ordensstaates (des Marienlandes), des seefahrenden Kaufmannes und der Großen Gilde in Riga. Außerdem verehrt wurde neben dem Heilige Mauritius auch der Heilige Martin, dessen Verehrung während des beginnenden 15. Jahrhunderts im Kreise der Bürger und Gesellen verbreitet war. Sie unterhielten in der Schwarzhäupter-Kapelle der St. Katharinenkirche ein Martinsbild. Und schließlich spielt der Heilige Georg eine wichtige Rolle, dessen Verehrung in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts Fuß fasste. Sie findet auch Ausdruck in einer der schönsten und prächtigsten Stück des heute noch erhaltenen Silberschatzes der Schwarzhäupter. Auch in der St. Petrikirche zu Riga unterhielten die Schwarzhäupter ihre Kerzen und zahlten dem Kirchenherrn ihre Gebühren. Sie bevorzugten die hinter dem Chor befindliche Nikolauskapelle. Dort standen im Jahre 1441 ihre Leuchterbäume. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts beteiligte sich die Compagnie am Umbau der inneren Kirchenräume. Am 28. Juni 1481 wurde der Rigaer Schwarzhäuptergesellschaft und „dem gemeinen deutschen Kaufmann aus Polozk" vom Rigaer Rat zum Bau eines eigenen Altars eine Stätte im Südschiff der Kirche bewilligt, so Thomsen. Über diese Vikarie wurde den Schwarzhäuptern das Patronatsrecht eingeräumt, wobei anfangs ein Ratsherr den Vorsitz führte und die Schwarzhäupter den Altar verwalteten und das Recht hatten, Priester anzustellen und abzusetzen.
Reformation und Bildersturm
Der Siegeszug der Reformation, die bereits im Jahre 1521 ihren Einzug im Livländischen Ordensstaat gehalten hatte, führte zu einem grundlegenden Wandel der Verhältnisse.
Seit dem Ende des Jahres 1522 wurden an den Pfarrkirchen zu St. Peter und St. Jakob keine katholischen Pfarrer mehr angestellt. Für die Compagnie bedeutet das eine Revolution. ...Weiterlesen
Im Laufe des Jahres 1523 fand die neue Lehre auch bei den Angehörigen der Compagnie der Schwarzhäupter Eingang, zunächst wohl unter den jüngeren Kaufgesellen. So berichtet Thomsen: „Am 10. März, dem Donnerstag nach Lätare, des Jahres 1524 versammelten sich im Neuen Haus die Schwarzhäupterältesten mit den anwesenden Kaufgesellen. Man war gewillt, der neuen Zeit Rechnung zu tragen und Änderungen in der Vikarieverwaltung vorzunehmen und den Unterhalt des Altars in der St. Petrikirche für Seelenmessen und Vigilien einzustellen."
Bevor es jedoch zur Ausführung dieses Beschlusses kam, war eine größere Zahl der jungen Brüder der Compagnie in die St. Petrikirche eingedrungen und hatte, wie Eric Thomsen schreibt, „in der Schwarzenhäupterkapelle alles durcheinandergeworfen und dabei manches beschädigt.“
Nach diesem „Bildersturm der Schwarzhäupter" erfolgte die endgültige Auflösung des Altars in der St. Petrikirche. Er wurde abgebrochen und stattdessen ein neues Gestühl für die Brüderschaft errichtet.
Am 12. Mai 1524 beschlossen der Schwarzhäupterältermann, Älteste und alle anderen Brüder, dass man, so Thomsen, „die ganze Rente, welche die Compagnie früher für den Unterhalt der Vikarie und Altäre zu entrichten hatte, alljährlich in die Kiste gebe, die in der St. Petrikirche für die armen Leute und Hausarmen gesetzt sei“, weil dieses Geld „zur Ehre Gottes bleiben solle".
Vieles vom Silberschatz der Vikarien wurde zu profanen Gefäßen umgeschmolzen.
So verfertigte z.B. ein Goldschmied im Jahre 1526 aus dem Silber einer Kirchenschale, zweier Kelche und anderen Silbers sechs neue vergoldete Becher mit dem Schwarzhäupterwappen. In der St. Petrikirche aber sorgte die Compagnie auch weiterhin für die Erhaltung ihres neuen Gestühls und der angrenzenden Bogenfenster, die mehrfach auf Kosten der Compagnie erneuert wurden.
Wehrhafte Bruderschaft
Die Schwarzhäupter bildeten im Mittelalter keinen eigenen Wehrverband. Auch haben sie nicht als geschlossene Einheit aktiv an den zahlreichen Kämpfen der Nachbarn Livlands um die Vorherrschaft im Ostseeraum teilgenommen, die sich zu einem großen Teil auf livländischem Territorium abgespielt haben.
Doch an den internen Fehden zwischen der Stadt Riga und dem Orden in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts nahmen die Brüder durchaus „regen Anteil“ ...Weiterlesen
Auch hat sich die Schwarzhäuptergesellschaft während dieser Bürgerkriege als kriegerisches Aufgebot an der Verteidigung der Stadt beteiligt. Eine kriegerische Vereinigung waren die Schwarzhäupter indessen nicht. Als der im Jahre 1561 seinen Höhepunkt erreichende Angriff der Russen zu einem Zerfall des Ordensstaates führte, haben die Schwarzhäupter sich an der Beschaffung schwerer Waffen für die Verteidigung Rigas beteiligt. So wurde im Jahre 1562 aus Spendenmitteln, welche die Schwarzhäupter aufbrachten, eine Kanone, das sogenannte „Große Schwarze Haupt", gegossen, die 3612 Mark gekostet haben soll. Im Jahre 1566 wurde auf Bestellung der Compagnie eine andere Kanone gegossen, eine sog. Falkonette, das „Kleine Schwarze Haupt". Im 16. und 17. Jahrhundert sind auf Betreiben der Schwarzhäupter noch weitere Kanonen gegossen worden, so z.B. zwei Viertelschlangengeschütze im Jahre 1576, und im Jahre 1579 eine Feldschlange, „deren Vorderlader das Mauritiuswappen schmückte.“ Zeitweilig lagerte die Munition sogar im Festsaal in einem Gewölbe, das sich unter der Musikantenbank befand. 236 eiserne Kugeln für das „Kleine Schwarze Haupt" wurden dort einmal aufbewahrt, aber auch die sogenannten „Potthunde", größere Geschützkugeln, deren jede mit dem Schwarzhäupterwappen gezeichnet war. Doch auch in kriegerischen Zeitläuften, so Thomsen, „überwogen das geselliges Leben und die soziale und karitative Betätigung der Compagnie.“
Für ihre Geschütze hat die Compagnie wiederholt Kugeln und Pulver gekauft.
Compagnie der Junggesellen
Die Ehelosigkeit der Brüder der Compagnie war durch äußere Bedingungen bestimmt. Als Kaufleute, die ihre Geschäfte über Handelswege zu See und über Land abwickeln und selbst begleiten mussten, waren die Mitglieder der Bruderschaft meist unterwegs. Die meisten fahrenden Schwarzenhäupter waren für gewöhnlich jüngere Männer. ...Weiterlesen
Gaben sie ihre unstete Berufstätigkeit auf, heirateten sie zumeist. Der Erwerb der Bürgerschaft war stets mit ihrer Verehelichung verbunden. Im Laufe des 16. Jahrhunderts wurde die Ehelosigkeit für die Schwarzenhäupter-Ältesten von der Compagnie zum Gebot erhoben; sie ist seit dem Jahre 1594 nachgewiesen. Bei ihrer Verehelichung schieden sie offiziell aus der Gesellschaft aus und wurden ausnahmslos Bürger und Brüder der Großen Gilde.
Große Feste
In den uns heute zugänglichen Darstellungen der Geschichte der Compagnie der Schwarzhäupter nimmt die Schilderung ihrer geselligen Veranstaltungen einen breiten Raum ein.
Dem Fastnachtsfest war, besonders unter den fahrenden Kaufgesellen, eine besonders bevorzugte Stellung eingeräumt. ...Weiterlesen
Hintergrund dieser besonderen Stellung der Fastnacht war auch, dass sie das Ende der Winterpause in der Schifffahrt und den Neubeginn der Handelsaktivitäten markierte. Auf die große Bedeutung der Fastnacht wird bereits in den Schragen der Companie der Kaufleute aus dem Jahre 1354 hingewiesen. Die Vorbereitungen für jenes Fest, das bis zu zwölf Tage lang gefeiert wurde, begannen um Weihnachten. Thomsen schildet den riesigen Aufwand, der für die Festlichkeiten getrieben wurde:
„11-12 Last Malz benötigte man für das Bier, 5 -6 Schiffspfund Honig für den Met - es wurde also nicht wenig getrunken. Für festliche Beleuchtung sorgten Kerzen aus Talg, für die man 260-280 Pfund Talg, und aus Wachs, für die man 90-100 Pfund Wachs benötigte. Am Montag um 7 Uhr in der Frühe wurde die Fahne mit dem Schwarzhäupterwappen am Neuen Hause ausgehängt; sie zeigte den Beginn des Festes an. Am Montag und Dienstag in der Fastnachtswoche fanden allgemeine „Pfennigtrünke" statt, auch lud man zu einem „Bierschmecken" ein."
"Bis Dienstagabend musste der Festsaal mit flämischen Wandteppichen, Gemälden und bemalten Wandbehängen aus Leinen geschmückt sein. Die offiziellen Fastnachtstrunke begannen am Mittwoch vor dem sogenannten „Kleinen Fastelavend" und währten ununterbrochen bis zum Aschermittwoch; dann begannen die öffentlichen Fastentrunke, die bis zum Dienstag in der Woche nach Invocavit fortgesetzt wurden."
Am „Kleinen Fastelavend" fanden Wettreiten nach dem Kranze auf dem Marktplatz statt. Am Sonntag begann der „Große Fastelavend", am Montag besuchte man das Rathaus und die Große Gilde; am Dienstag fand mit den Frauen und Jungfrauen ein allgemeines Festessen statt, dem am Mittwoch eine öffentliche Versammlung folgte, auf der auch Gericht gehalten wurde.
Ein Kirchgang in die St. Petrikirche folgte am Donnerstag, worauf am Freitag der Rat in das Neue Haus geladen wurde und ein Empfang der Ältesten der Großen Gilde folgte. Dass an diesen Tagen nicht nur getrunken, sondern auch eifrig getanzt wurde - und dies nicht nur im Neuen Hause, sondern auch auf dem Marktplatz - versteht sich von selbst. Erst am Dienstag fand das Fest sein endgültiges Ende.“
Der gesellige Verkehr im Neuen Haus wurde durch die Schragen geregelt, die im Laufe der Zeit wiederholt ergänzt und verändert wurden.
In der Schafferordnung vom Jahre 1640 heißt es u.a.: „Weil etliche grobe Gesellen sich nicht im Trinken zu mäßigen wissen, so soll der, welcher sich auf dem Hause oder der Treppe des Getrunkenen entledigt, 30 Mark Strafe geben. Keiner soll mit dem Degen erscheinen, sondern ihn beim Eintritt dem Diener abgeben.“
Zaren und heimliche Besucher
Im 17. und 18. Jahrhundert bestand in Riga der Brauch, dass sich beim Empfang illustrer Gäste der Stadt auch die Schwarzhäupter mit einer „Ehrengarde zu Pferde an offiziellen Aufzügen in hellblauen Uniformen mit silbernen Knöpfen, ledernem Kamisol und einem mit silbernen Tressen besetzten federgeschmückten Hut beteiligten.“
Am 21. November 1711 besuchte Peter I. von Russland das Schwarzhäupterhaus. ...Weiterlesen
Über diesen großen Tag berichten die Quellen: "Er kam in Begleitung einer größeren Suite mit dem Fürsten Menschikow vor den Artushof angeritten, stieg vom Pferde und ging sogleich ohne Umstände zu machen die Treppe hinauf in den Versammlungssaal, um die vom Bombardement verursachten Schäden in Augenschein zu nehmen. Zum Schwarzenhäupterältesten Cordes, der den Zaren im Hause herumführte, gesellten sich bald darauf der Schwarzenhäupterälteste Gäsche mit mehreren anderen Ältesten. Nach der Besichtigung nahm Zar Peter neben dem Fürsten Menschikow Platz. In aller Eile war von der Companie so viel man nur konnte an Getränken angeschafft worden. Die vornehmen Gäste blieben über drei Stunden im Hause beisammen, wobei die Musik die Trompeten und Pauken lustig ertönen ließ. Äußerst zufrieden solle hierauf der Zar das Neue Haus mit seiner Suite verlassen haben.“ Es müssen rauschende Feste gewesen sein. Manche berühmten Gäste kamen daher lieber heimlich. Im Jahre 1764 beteiligte sich Katharina II. von Russland sogar incognito an einem Maskenball. Unter dem angenommenen Namen eines Grafen von Falkenstein besuchte Kaiser Joseph II. im Jahre 1780 das Schwarzhäupterhaus.
Besitzer des Schwarzhäupterhauses
Im Laufe der Zeit ging die innere Verwaltung des Neuen Hauses vom Rat immer mehr in die Hände der Schwarzhäupter über.
Zwischen der Großen Gilde und den Schwarzhäuptern kam es 1687 zur Lösung des Pachtvertrages. Von diesem Jahre an waren die Schwarzhäupter alleinige Nutznießer des Hauses, das nun zum „Schwarzhäupterhaus" wurde. ...Weiterlesen
Mit Ausnahme größerer Festveranstaltungen mit geladenen Gästen diente es immer mehr als Versammlungsstätte der Schwarzhäupter, bis es schließlich im Laufe des 17. Jahrhunderts aufhörte, als öffentliches Versammlungshaus zu dienen.
Durch Eintragung in das Grundbuch im Jahre 1793 ging es schließlich endgültig in den Besitz der Compagnie über.
Kaiserliche Gäste, berühmte Mitglieder
Im Jahr 1802 war wiederum ein Zar Gast der Schwarzhäupter in Riga. Alexander I. von Russland kam zu einem glänzenden Ball der Compagnie, nachdem Zar Paul I. bereits im Jahre 1796 im Neuen Hause geweilt hatte.
Im Jahre 1808 besuchten es König Friedrich Wilhelm III. von Preußen und Königin Luise. ...Weiterlesen
Dreimal hat schließlich auch Zar Alexander II. von Russland das Neue Haus betreten: 1829 als Thronfolger, ferner im Jahre 1856 und zuletzt 1862.
Über die Ehrenmitglieder der Compagnie wiederum geben die vorliegenden Quellen keine erschöpfende Auskunft. Dass es illustre Persönlichkeiten in größerer Zahl gab, die man zu Ehrenmitgliedern erwählt hat, geht aus dem im Jahre 1831 veröffentlichten Buch von G. Tielemann hervor, in dem es heißt:
„In der neuesten Zeit zeichneten Russlands Kaiserinnen Elisabeth, Alexandra Feodorowna und der Großfürst und Thronfolger Alexander Nikolajewitsch ihre Namen ins Bruderbuch. Von den übrigen Ehrenmitgliedern heben wir hier nur den gegenwärtigen Präsidenten Griechenlands, Capo d'Istrias, den Erzbischof von Pskow, Eugenius, den Archimandrit Athanasius, die Fürsten Potemkin, Repnin und Graf Wittgenstein aus."
Was Zahl und Herkunft der Mitglieder der Compagnie betrifft, so gibt darüber ein „Verzeichnis der von 1658 bis 1831 erwählten Mitglieder der Schwarzen-Häupter (aus dem „Goldenen Buche" der Gesellschaft)" Auskunft, das bei Tielemann (1831) abgedruckt und im Neudruck (1970) durch ein Verzeichnis der seit 1832 erwählten Mitglieder ergänzt worden ist.
Das Verzeichnis für die Jahre 1658-1831 enthält die Namen von 544 Personen, „von denen 353 als „Hiesige" (also aus Riga gebürtig)“ bezeichnet werden. Die übrigen stammten aus ganz Europa, von Russland, über Norwegen, Schweden, Schottland, England, Holland, Frankreich bis Italien, sowie in späteren Jahren Canada.
Wagner im Schwarzhäupterhaus
Insbesondere im 19. Jahrhundert war das Schwarzhäupterhaus in Riga ein Zentrum für gesellschaftliche und kulturelle Anlässe.
Man begann, den Festsaal für Veranstaltungen, Vorträge und Konzerte zu vermieten, für die er dank seiner hervorragenden Akustik einen würdigen Rahmen bildete. ...Weiterlesen
Die Büsten von Bach und Beethoven, Gluck, Haydn, Schumann und Weber zieren das Treppenhaus zum großen Festsaal im ersten Stock. Sie wurden im Jahre 1861 von der musikalischen Gesellschaft gestiftet.
So gab auch Richard Wagner, der von 1837 bis 1839 als Kapellmeister in Riga angestellt war, Konzerte im Schwarzhäupterhaus. In Riga begann er auch die Arbeit am „Fliegenden Holländer“.
Und weiter kamen illustre Gäste, wie Thomsen schreibt:
„Im Jahre 1849 weilte Prinz Alexander von Hessen in seinen Mauern, 1875 König Oskar von Schweden, 1876 Prinz Friedrich Karl von Preußen und 1883 Prinz Karl von Schweden. Außerdem sind Mitglieder des russischen Herrscherhauses bei ihren Aufenthalten in Riga wiederholt Gäste des Schwarzhäupterhauses gewesen, wo sie an Empfängen zu ihren Ehren teilgenommen haben.“
Bruderschaft in Lettland
Am 18. November 1918 erklärt Lettland infolge des Ersten Weltkrieges seine Unabhängigkeit. Und auch nachdem die Schwarzhäupter damit von Untertanen des Zaren zu Bürgern in der Republik Lettland geworden waren, verfolgten sie weiterhin die historischen Ziele, nunmehr in der Rechtsform eines Vereins. ...Weiterlesen
Noch die erneuerten Statuten von 1924 schrieben jede Art der Förderung kultureller und gemeinnütziger Bestrebungen und humanitäre Einrichtungen, die Unterstützung verarmter Mitglieder und die Pflege geselligen Zusammenseins vor. Die Zahl der Mitglieder in Riga schwankte jeweils zwischen 25 und 30.
Abschied von Riga
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland begann der Weg in die Katastrophe. Deutschland brachte mit dem Zweiten Weltkrieg Leid und Zerstörung in die Welt.
Als Konsequenz des Hitler Stalin-Paktes, der Deutschlands Angriff auf Polen und ganz Europa vorbereitete und die Umsiedlung der deutschen Volksgruppen aus Estland und Lettland nach Polen vorsah, erfolgten 1939 die Zwangslöschung der Compagnie im Vereinsregister von Riga und die Zwangsaussiedlung (sogenannte „Diktierte Option“) ihrer Mitglieder. Die Compagnie bestand aber – jedenfalls als Gesellschaft bürgerlichen Rechts – weiter. ...Weiterlesen
Thomsen schreibt: „Am letzten Brudermahl, das die Compagnie in ihrem Haus in Riga abhalten konnte, nahm der berühmte Chirurg Ferdinand Sauerbruch als Gast teil. Dem deutschen Leben im Schwarzhäupterhause setzte im Jahre 1939 die Umsiedlung der Deutsch-Balten ein Ende.“ Als die Compagnie nach über 700 Jahren Riga verlassen musste, wurden ihr „zur Ausfuhr nach Deutschland“ insgesamt 67 Gegenstände zugestanden, darunter ein Teil des Silberschatzes.
Im Jahre 1941 wurde auch das Haus selbst ein Opfer des Krieges. Als am 28. Juni 1941 das Schwarzhäupterhaus in Flammen aufging, fiel ihnen auch die gesamte wertvolle Innenausstattung zum Opfer.
Ein neues Kapitel
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die überlebenden Mitglieder der Compagnie über ganz Deutschland, Europa und darüber hinaus verstreut, in Ländern wie den Niederlanden, Schweden und Kanada. Viele hatten die von Deutschland ausgegangene Katastrophe des Krieges, von Flucht und Vertreibung, nicht überlebt. ...Weiterlesen
Erst langsam gelang es ihnen, sich durch Briefe, private Nachforschungen und Aufrufe in Heimatzeitungen wie den „Baltischen Briefen“ wieder zu finden und zu versammeln, zunächst in Hamburg. „Die altehrwürdige Compagnie“, schreibt Erik Thomsen, „die so ganz als ein Stück Mittelalter in eine andere Gegenwart hineinragte, hat es verstanden, deutscher Kunst und Geistigkeit eine Heimstätte zu schaffen, wie sie würdiger kaum gedacht werden konnte. Das ist das Verdienst dieser mittelalterlichen Brüderschaft, ein Stück schönster Tradition über Jahrhunderte erhalten zu haben."
Von Hamburg nach Bremen
Die Compagnie, die als Gesellschaft bürgerlichen Rechts nie aufgehört hatte, zu existieren, ließ sich in der Bundesrepublik Deutschland am 29. November 1961 zunächst in Hamburg auch wieder im Vereinsregister eintragen – mit dem Namenszusatz „aus Riga“ statt bisher „zu Riga“.
Doch die Kontinuität blieb erhalten: Mitglieder waren noch 1961 nur solche, die auch in Riga schon Mitglieder gewesen waren. ...Weiterlesen
Vereinszweck der „Compagnie der Schwarzen Häupter aus Riga e.V.“ ist laut Paragraph 2 der Satzung:
„Pflege und Förderung kultureller und gemeinnütziger Bestrebungen eines ehrbaren Kaufmanns und die Bewahrung hanseatischer Tradition. Diese Aufgabe wird durch Förderung kaufmännischer Interessen, Beratung und Unterstützung erfüllt, ferner durch Erhaltung des bestehenden Archivs und der noch vorhandenen Werte der Compagnie der Schwarzen Häupter.“
Seit dem 11. Dezember 1980 ist der juristische Sitz der Kompanie Bremen, Versammlungsort ist das Haus Schütting am Markt in Bremen.
Literatur
Die hier dargestellte Chronologie folgt eng und in weiten Strecken wörtlich den wichtigsten historischen Darstellungen der Geschichte der Compagnie der Schwarzen Häupter. ...Weiterlesen
Dabei wurde aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf detaillierte Zitierungshinweise im Text verzichtet. Hier eine Übersicht der wichtigsten Quellen:
- Thomsen, Erik: Die Compagnie der Schwarzen Häupter aus Riga und ihr Silberschatz“. Lüneburg 1974. Nachdruck durch die Compagnie der Schwarzen Häupter aus Riga e.V. (Bremen) 2012
- Koch, Hans-Albrecht: „Rigische Geschichte im Spiegel der Compagnie der Schwarzen Häupter.“ In: Anczykowsky, Maria et al.: „Der Silberschatz der Compagnie der Schwarzen Häupter aus Riga.“ Kunstsammlungen Böttcherstraße. Bremen 1997
Vgl. außerdem:
- Tielemann, G.: Geschichte der Schwarzen Häupter in Riga nebst einer Beschreibung des Artushofes und seiner Denkwürdigkeiten. Verlag W. F. Häcker, Amsterdam 1970
- Spliet, Herbert: Geschichte des Rigischen Neuen Hauses, des später sog. König Artus Hofes, des heutigen Schwarzhäupterhauses zu Riga, Ernst Plates, Riga, 1934